Auswahl eines geeigneten Elektromotors
1. Einleitung
 HINWEIS:
HINWEIS:Nachfolgende Erläuterungen sind nicht für bürstenlose Elektromotoren anwendbar.
Die Ziele dieses Kapitels sind Antworten auf folgende Fragen zu liefern:
- Welche Aspekte beeinflussen Drehmoment und Drehzahl eines Elektromotors?
- Was sagen die Herstellerangaben aus?
- Was muss ich wissen um einen Elektromotor auszuwählen der meine Anforderungen erfüllt?
2. Physik "diktiert" Eigenschaften des Elektromotors
Aus diesen Grundlagenbetrachtungen resultieren folgende Aspekte, welche für die Auswahl eines geeigneten Elektromotors für unsere Zwecke relevant sind:
- Länge der Ankerwicklung
(Je länger ein Elektromotor ist, desto höher ist dessen Drehmoment) - Möglichst grosser Ankerdurchmesser
(Je grösser der Durchmesser des Elektromotors ist, desto höher ist sein Drehmoment) - Hohe Polpaarzahl
(Gleichmässige Drehzahlen und Drehmomentabgabe bereits bei niedrigen Drehzahlen) - Eingesetzter Magnetwerkstoff
sollte möglichst hohe magnetische Flussdichte aufweisen
(Je höher diese ist, desto höher ist das Drehmoment) - Betrieb im Bereich des höchsten Wirkungsgrades
(Je näher der Elektromotor an seinem optimalen Wirkungsgrad betrieben wird, desto optimaler ist die "Ausbeute" an eingesetzter Energie aus dem Fahrakku)
3. Herstellerangaben geben viele Antworten
Ein Wort zu Spannungsangaben:
Die obere Drehzahlgrenze ist im wesentlichen abhängig von mechanischer Konstruktion und thermodynamischen Faktoren. Zu hohe Fliehkräfte, Funkenflug oder übermässige Erhitzung führen typischerweise zur Verringerung der Lebensdauer, respektive zur Zerstörung des Ankers. Eine 'untere Grenzdrehzahl' gibt es in diesem Sinne nicht, jedoch sind unterhalb einer gewissen Drehzahl (typischerweise unterhalb von 4V bei Motoren für unseren Zweck) die sogenannten Anlaufverluste im Verhältnis zu gross (= Motor steht still), sodass die im weiteren verwendeten Näherungen nicht mehr gültig sind. Bei Glockenankermotoren (Bsp. Maxon, Faulhaber) laufen bereits schon bei Spannungen von 1-1,5V an, spielt aber für die nachfolgenden Betrachtungen keine Rolle)
Wichtige Kenngrössen:
|
|||
Die Stromstärke dürfte nebst dem Drehmoment (also ob ein E-Motor "kräftig" ist), die zweite Grösse sein, welche von grossem Interesse für den Modellbauer ist. Hat letzere doch direkten Einfluss auf den Energielieferanten - den Akku. Ich wage zu behaupten, dass wir alle gerne einen daumennagelgrossen Akku hätten, der unser 20kg-Modell stundenlang mit Energie versorgt.
Genau die beiden letztgenannten Grössen sind miteinander "verheiratet" (vgl. Kapitel 'THEORIE EMOTOR' im Menu 'FAQs'). Nach dem Kauf eines E-Motors kann das Drehmoment nur mit der zugeführten Stromstärke (innerhalb der Betriebsgrenzen) verändert werden - die Ankerlänge und -durchmesser sowie der magnetische Werkstoff sind vom Hersteller gegeben. Also muss vor dem Kauf darauf geachtet werden, dass die Ankerlänge- und der Durchmesser den Anforderungen genügen und eventuell ein hochwertiger Magnetwerkstoff zum Einsatz gelangt.
Wo sind die Grenzen?
Das sogenannte 'Ohmsche Gesetz' sagt, dass sich der (Motor-)Strom aus der angelegten Spannung, dividiert mit dem ohmschen Widerstand (der Ankerwicklung) ergibt. Den Gesetzen der Physik folgend, erwärmt sich ein Leiter mit ohmschen Widerstand [R], sobald dasss er von einem Strom [I] durchflossen wird.
Solange der Leiter die sogenannte 'Wärmeenergie' an seine Umgebung abgeben kann (typischerweise die Umgebungsluft), findet keine thermische Beschädigung des Leiters statt. Der ohmsche Widerstand eines elektrischen Leiters ist jedoch ahängig von der Temperatur. In Abhängigkeit des verwendeten Materials verringert sich dieser (Bsp. Kupfer), oder erhöht sich (Bsp. Wolframwendel in Glühbirne). Die Ankerwicklungen bestehen typischerweise aus ersterem Material was soviel bedeutet, dass der ohmsche Widerstand bei Erwärmung sinkt und die Stromstärke dadurch ansteigt. Dadurch erwärmt sich der Leiter noch mehr; der Widerstand sinkt weiter ab und der Strom steigt weiter an. Dieser Vorgang kann zerstörerische Wirkung haben, da ab einer gewissen Temperatur der Isolierlack der einzelnen Ankerwicklungen schmilzt und Kurzschlüsse in den Wicklungen entstehen. Bei vielen Elektromotoren werden sich jedoch andere Teile zuvor verabschieden - beispielsweise Lötstellen wo Ankerwicklungen mit dem Kommutator verbunden sind, oder Kunststoffhalterungen der Kohlebürsten. Speziell empfindlich auf Überströme, respektive Übertemperaturen sind Glockenankermotoren, da deren Wicklungen nicht um einen Eisenanker gelegt sind, welcher die Wärme der Wicklungen aufnehmen kann, sondern die Wärme nur über die Luft abgegeben werden kann.
Da unser Modellfahrzeug typischerweise beim Anfahren das höchste Drehmoment benötigt und dieses nach der Beschleunigungsphase wieder abnimmt, sinkt die Stromstärke ebenfalls und damit die Erwärmungszunahme der Ankerwicklung. Ein blockierter E-Motor ist demnach ein "Selbstmörder", wenn wir ihn nicht mit geeigneten Mitteln davon abhalten. Man sollte beachten, dass Akkus kurzzeitig extrem hohe Ströme abgeben können. Die Höhe des Stromes ist praktisch nur abhängig vom Widerstand des Kurgeschlossenen Stromkreises, der typischerweise gering ist, sowie dem Akkutyp und dessen Kapazität. Demnach ist eine Absicherung gegen solch hohe Ströme unbedingt vorzusehen. (Auch wenn der Fahrtregler eine Schutzfunktion vor 'Überströmen' bietet) Die altbekannte Schmelzsicherung bietet sicheren Schutz gegen zu hohe Ströme und muss so nahe als möglich im Stromkreis des Akku's befestigt werden! Die Unsitte, "fliegende" Schmelzsicherungen durch solche mit höherem Stromwert (oder gar Aluminuimfolie oder dergleichen) zu ersetzen ist gefährlich! Die maximale Stromstärke und deren Zeitdauer, welche ein EMotor aufnehmen kann resp. darf, entnimmt man Hersteller-Datenblättern.
(Auf Dimensionierung von Akku, Drehzahlsteller (="Fahrregler") und Sicherung(en) wird zu einem späteren Zeitpunkt in einem separaten Kapitel eingegangen.)
4. Hilfreiche Diagramme
Das Beispiel-Diagram 1 zeigt die Abhängigkeiten der zugeführten Grössen 'Strom' und 'Spannung' mit den abgeführten Grössen Drehmoment und Drehzahl:
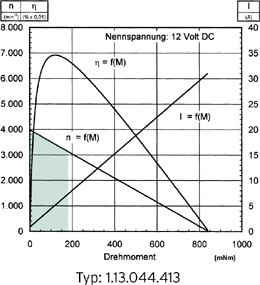
Diagram 1: (Quelle: Firma Bühler)
Man erkennt, dass alle "vertikalen Werte", also Strom, Drehzahl und Wirkungsgrad als Funktion des Drehmomentes dargestellt werden. Das Drehmoment ist auf der horizontalen Achse dargestellt. Wichtig anzumerken: Alle Werte haben nur Gültigkeit bei einer konstanten Gleichspannung von 12 Volt (sog. Nennspannung) wie im Diagramm angegeben ist.
Beispiel anhand Diagram 2:
Interessiert uns beispielsweise die Stromaufnahme, so sagt uns das Diagramm folgendes (beginnend bei Nummer 1): Die höchste Stromaufnahme (ca. 31A) ergibt sich bei maximalem Drehmoment (ca. 850mNm) und nimmt linear mit dem Dremoment ab bis zum Wert '0'. Also beispielsweise bei 15A steht ein Drehmoment von 400mNm am Abtrieb zur Verfügung.
ANMERKUNG: Blockiert man den Elektromotor im späteren Betrieb, so ist 1.) das Drehmoment um ein vielfaches höher als das (meist in Modellbaukatalogen) angegebene Nenndrehmoment (Wellenverbindungen, Kardangelenke werden u.U. zerstört) und 2.) Die Stromaufnahme weit über die vom Hersteller maximal zulässige Stromaufnahme, welche meist NICHT explizit in den Diagrammen steht, sondern üblicherweise separat zu finden ist. Die 31A in diesem Beispiel sind also so zu verstehen, dass unser Elektromotor tunlichst nicht blockiert oder derart gebremst werden möchte, dass er ständig ausserhalb des Betriebsbereiches betrieben wird. Hat man also das notwendige Drehmoment für den Vortrieb des Modellfahrzeuges abgeschätzt, kann anhand des Diagrammes die Stromaufnahme abgelesen werden.
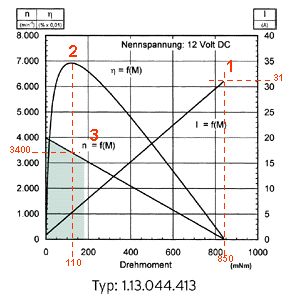
Diagram 2: Betriebsbereiche
Von Interesse ist zudem der Wirkungsgrad (Nummer 2), der in diesem Beispiel bei einem Drehmoment von ca. 110mNm mit knapp 70% am höchsten ist.
Bei diesem Motortyp verpuffen bei maximalem Wirkungsgrad rund 30% der zugeführten Energie infolge von mechanischen und elektrischen Verlusten. Bei der Drehzahl n=0 und dem Drehmoment M=850mNm beträgt der Wirkungsgrad Null, die zugeführte Energie verpufft wirkungslos in Wärme (und der Motor stirbt infolge Überhitzung). Die Drehzahl (siehe Nummer 3) verhält sich ebenfalls linear zum Drehmoment.
Der dunkel hinterlegte Bereich ist wie besagt der vom Hersteller empfohlene Betriebsbereich dieses Motors; also im Drehzahlbereich zwischen 3100 -3800 1/min, einer Stromaufnahme von bis zu 6,5A und in der Nähe des maximalen Wirkungsgrades.
Welches Drehmoment bei welcher Drehzahl geeignet ist für den Einsatz im Modell, ist im Kapitel 'ANFORDERUNGEN AN DEN MODELLANTRIEB' beschrieben.
Die Getriebeberechnungen (siehe Kapitel 'GETRIEBEPLANUNG' ) ergeben zusätzlich noch die Grösse:
- Erforderliche Eingangsdrehzahl des Getriebes (= Nenndrehzahl des Elektromotors)
Mit diesen Werten lassen sich anhand solchen Diagrammen recht schnell und einfach geeignete Elektromotoren bestimmen.
5. Die "zwei Gesichter" der Leistung
In diesem Kapitel als auch in denen über die Grundlagen des Elektromotors ist vor allem die Rede von Drehmomenten und Stromaufnahme. Es wurde dargelegt, wie die Grössen zustande kommen und wie die abgegebene Leistung aus den Herstellerdiagrammen entnommen werden kann, da typischerweise nicht linear und grundsätzlich von den Faktoren Drehzahl, Ankerspannung ("Betriebsspannung") und Belastung abhängt.
"Warum?" fragt man sich, denn da gibt es ja genügend Beispiele von Modellen die mit Leistungsangaben im dreistelligen Bereich nur so strotzen.... "Motor mit 400W", "... eine Leistung von 500W...", usw. Nun, es gibt da einen kleinen Haken an der Sache mit der Leistung. Die mechanische Leistung setzt sich aus den beiden Grössen Drehmoment und Drehzahl zusammen. Für die Berechnung der Leistung gilt als Näherung:
P = (M * n * η) / 9.55
Dabei ist 'P' die Leistung in Watt [W], 'M' das Drehmoment in
Newtonnzentimetern [Ncm], 'n' die Drehzahl in Umdrehungen pro Minute [1/min] und 'η' der Wirkungsgrad als Faktor.
Für das nachfolgende Beispiel spielt es keine
Rolle, welchen Wirkungsgrad man einsetzt und folgende
Näherung η/9.55 =
0.1 genügt für nachfolgendes Beispiel wo es
nur darum geht, die Abhängigkeit der Leistung von Drehmoment und
Drehzahl zu zeigen.
Die vereinfachte Formel lautet somit:
P = M * n * 0.1
In Worten ausgedrückt, kann man also dieselbe Leistung entweder mit hohen Drehzahlen und geringem Drehmoment (Beispiel: Automobil) oder geringer Drehzahl und hohem Drehmoment erreichen (Beispiel: Lastwagen). Vier Beispiele eines Modellfahrzeuges, ausgerüstet mit einem Elektromotor mit 400 Watt mechanischer Leistung:
400W = 0.1 * 2.0 Nm * 2'000 1/min
400W = 0.1 * 1.0 Nm * 4'000 1/min
400W = 0.1 * 0.5 Nm * 8'000 1/min
400W = 0.1 * 0.2 Nm * 20'000 1/min
Schaut man nun in die Herstellerkataloge der (Modellbau)Lieferanten,
so entdeckt man, dass ein Grossteil aller angebotenen Elektromotoren Drehzahlen
jenseits von 10'000 1/min aufweisen und eher kleiner Bauart sind. Die
theoretischen Elektromotor-Grundlagen haben aufgezeit, dass ein hohes Drehmoment
auch einen grossen Ankerdurchmesser erforderlich macht.
Ergo heisst "hohe
Leistung" noch lange nicht "hohes Drehmoment". Dieses wird
nun typischerweise mit einem nachgeschalteten Getriebe erreicht, welches
a) die Drehzahl reduziert und
b) linear dazu das Drehmoment (am Abtrieb)
erhöht.
Ein Elektromotor mit
hohem Drehmoment bei niedriger Drehzahl erspart sich
zwei Dinge:
a) Keine grossen Getriebeübersetzungen um die
hohe Drehzahlen auf eine (Modellnutzfahrzeug-) typische Drehzahl
zu bringen und
b) Hohe Stromaufnahmen in Verbindung mit schlechten Wirkungsgrade von
hochdrehenenden Modell-Elektromotoren (wie sie z.B. bei RC-Cars eingesetzt werden)
Man "erkauft" sich den Vorteil eines solchen "Langsamläufers" wiederum
indem man
a) die Getriebekonstruktion entsprechend dem höheren Drehmoment
auslegen muss (Grösse, Gewicht, ev. Preis) und
b) für einen
Langsamläufer oftmals tiefer in die Tasche greifen muss.
6. Fazit
- Wie hoch muss das notwendiges Drehmoment am Radabtrieb sein
damit das Modell die (gewünschten) Fahrsituationen meistern kann?
(Relevant zur Definition des vom Elektromotor abzugebenden Drehmoment) - Welche Drehzahl muss der Elektromotor aufweisen? (Auch unter Belastung!)
Diese Werte können durch Abschätzungen des geplanten oder Ermittlung am fertigen Antriebsstrang gefunden werden. Zudem sind diese Werte noch vom eingesetzten Getriebe abhängig. Aus diesem Grund sollte die Auslegung des Getriebes vor (!) der Auswahl des Elektromotors gemacht werden.